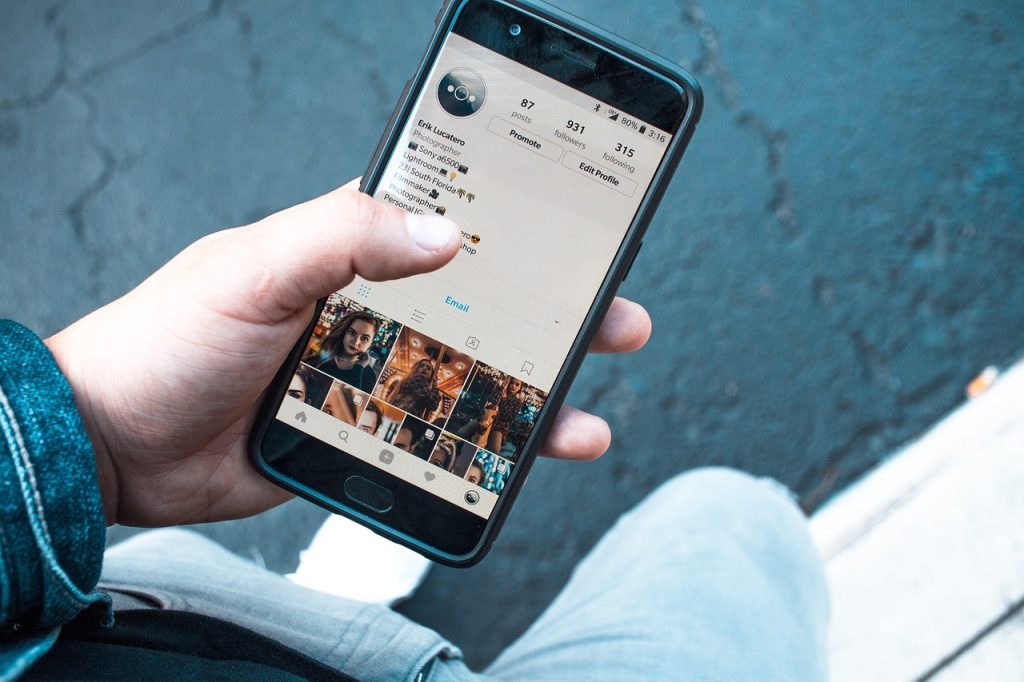Seit 1998 wird mit der JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) im jährlichen Turnus eine Basisstudie zum Medienumgang der Zwölf- bis 19-Jährigen durchgeführt. Neben einer aktuellen Standortbestimmung sollen die Daten zur Erarbeitung von Strategien und Ansatzpunkten für neue Konzepte in den Bereichen Bildung, Kultur und Arbeit dienen.
Die JIM-Studie ist als Langzeitprojekt angelegt. So werden einerseits allgemeine Entwicklungen und Trends kontinuierlich abgebildet und dokumentiert, gleichzeitig werden in den einzelnen Untersuchungen spezifische Fragestellungen realisiert, um aktuelle Medienentwicklungen aufzugreifen.
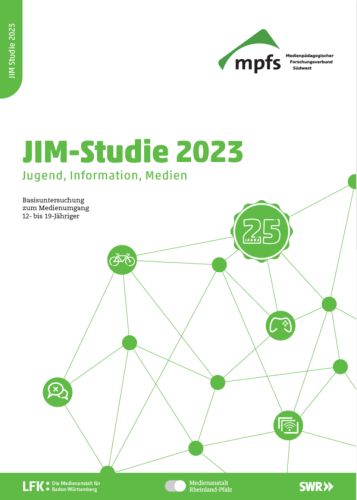
Musik ist ein zentrales Element, das zur Identitätsfindung Jugendlicher dazugehört. Wie vor 25 Jahren gehört das Hören von Musik auch heute zu den häufigsten Medienaktivitäten. Die Zugangswege haben sich jedoch stark erweitert. Heute ist der Zugang zu Musik über verschiedenste Wege möglich. 79 Prozent der in der JIM-Studie 2023 Befragten haben zu Hause Zugriff auf einen Musikstreaming-Dienst wie Spotify, Apple music, Amazon Prime music oder YouTube music. Die große Bedeutung von Musikstreaming-Diensten im Alltag wird auch mit Blick auf die Nutzungsdauer deutlich.
An einem durchschnittlichen Tag hören Jugendliche nach eigener Einschätzung 115 Minuten Musik über Spotify & Co., wobei Mädchen (124 Min.) eine höhere Nutzung aufweisen als Jungen (106 Min.). Im Altersverlauf werden Musikstreaming-Dienste tendenziell immer beliebter (12-13 Jahre: 72 Min., 14-15 Jahre: 111 Min., 16-17 Jahre: 146 Min., 18-19 Jahre: 130 Min.). Der Rückgang im Alter von 18-19 Jahren könnte auf die mangelnde Zeit durch Abitur oder Ausbildung/Arbeit zurückzuführen sein. Im Vergleich zu 2022 ist die durchschnittliche Nutzung insgesamt um 17 Minuten angestiegen.
Radio als weiterer Zugangsweg zu Musik, Nachrichten und weiteren Inhalten wird von 58 Prozent der Jugendlichen regelmäßig gehört und ist damit in den letzten Jahren stabil geblieben (2022: 57 %, 2021: 58 %, 2020: 58 %). Weitere 15 Prozent hören einmal pro Woche Radio, 13 Prozent einmal pro Monat oder seltener, 13 Prozent hören nie Radio. Mädchen weisen eine etwas höhere regelmäßige Radionutzung auf (Mädchen: 62 %, Jungen: 55 %). Mit zunehmendem Alter geht die regelmäßige Nutzung etwas zurück.
Ein weiteres Element der Audionutzung stellen Podcasts dar. Zwei Drittel der Jugendlichen hören Podcasts, 22 Prozent nutzen sie regelmäßig. Dabei bestehen zwischen den Geschlechtern keine großen Unterschiede.