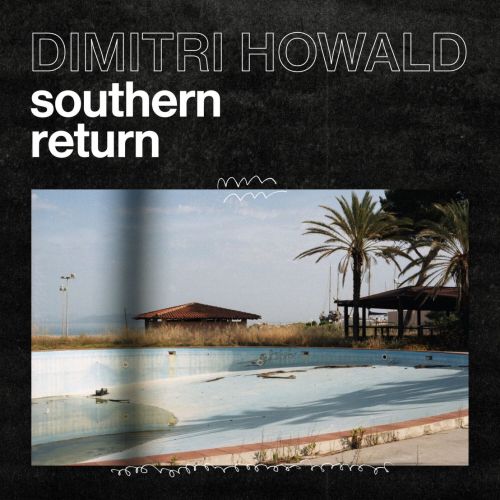STREETMARK wurde 1968 in Düsseldorf gegründet, als Dorothea Raukes, die klassische Musik studiert hatte und Keyboards spielte, die Brüder Thomas und Bernd Schreiber, beide Gitarristen, kennenlernte. Dorothea und Thomas bildeten die Keimzelle der Band. Anfangs spielte STREETMARK hauptsächlich Coverversionen der Beatles, John Mayall und Deep Purple.
1969 lehnten sie ein Angebot für einen Plattenvertrag ab. In den folgenden fünf Jahren entwickelte STREETMARK ihren eigenen Stil, der hauptsächlich auf den Kompositionen von Dorothea und Thomas basierte und von Procol Harum, Focus und ELP beeinflusst war. 1975 nahmen STREETMARK ihr Debütalbum „Nordland“ für Sky Records auf.
Produziert und aufgenommen wurde die Platte von Conny Plank in folgender Besetzung: Dorothea Raukes (Keyboards), Thomas Schreiber (Gitarre), Hans Schweiss (Schlagzeug), Georg Buschmann (Gesang), Wolfgang Westphal (Bass). Bernd Schreiber war für den Mix und das Soundboard zuständig.
„Nordland“ ist ein hervorragendes Debütalbum, die Band hat sich die Zeit genommen, die Kompositionen live zu spielen und auszuarbeiten. Das allgemeine musikalische Niveau ist recht hoch; der einzige Schwachpunkt ist, wie so oft bei deutschen Bands, der englische Gesang.
1977 veröffentlichten STREETMARK ihre zweite Platte „Eileen“ mit Wolfgang Riechmann, einem Solokünstler, der sich der Band als Sänger und Keyboarder angeschlossen hatte. Tragischerweise wurde er 1978 ermordet, noch vor der Veröffentlichung seines Soloalbums „Wunderbar“. Sky Records veröffentlichte „Eileen“ 1979 unter dem neuen Titel „Wolfgang Riechmann and Streetmark“ mit einem Bonustrack neu. Später wurde die Platte in „Dreams“ umbenannt. Die dritte (vierte) Platte „Dry“, komplett instrumental, wurde 1979 veröffentlicht. 1981 veröffentlichten STREETMARK ihre letzte Platte „Sky Racer“, mit Dorothea Raukes als einzigem verbliebenen Gründungsmitglied. Es ist immer noch ein interessantes Album, aber viel mehr vom Pop beeinflusst.