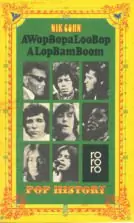
Das 1968 geschriebene und 1972 überarbeitete „Awopbopaloobop Alopbamboom“ war das erste Buch, das die Sprache und die ursprüngliche Essenz des Rock ’n‘ Roll feierte. Aber es war noch viel mehr als das. Es war eine überzeugende Geschichte einer widerspenstigen Ära, vom Aufstieg von Bill Haley bis zum Tod von Jimi Hendrix.
Und während er unerhörte Geschichten erzählte, die Musik anschaulich beschrieb und den Hype durchbrach, begründete Nik Cohn eine neue literarische Form: die Rockkritik. Im Gefolge seines Buches hat sich die Rockkritik zu einer regelrechten Industrie entwickelt, und die Welt der Musik ist nicht mehr dieselbe.
Nik Cohns Reportage von der Rockfront ist mehr als 55 Jahre alt (der Autor geht auf die 80 zu) und ist immer noch so wild wie damals, als er 1969 auf die Szene stürmte. Seitdem sind viele skandinavische Wälder abgeholzt worden, um die Pop-Revolution zu beschreiben. Namen wie Greil Marcus, Philip Norman und Jon Savage drängeln sich an der Spitze eines überfüllten Feldes um Aufmerksamkeit, aber Nik Cohn war der erste. Keiner hatte das Thema so ernst genommen wie er. Auf 250 Seiten wurde eine neue Form der Rockkritik vorgestellt.
Dies war eine neue Art des kritischen Diskurses, eine mit jugendlicher Intensität. „Vom ersten Hauch von Tutti Frutti an“, schreibt Cohn, “hatte mich der Rock’n’Roll mit Leib und Seele in Besitz genommen.“ Von 1956 bis 1968 berichtete er über den „ersten verrückten Rausch“ eines Phänomens, das sich schließlich in Disco, Heavy Metal, Grunge, Glam, Techno, Punk und viele bizarre Subgenres verwandeln sollte.
Zunächst schrieb Cohn als Freiberufler, der durch die Straßen von Soho streifte, und später für das supercoole Magazin Queen. Schließlich bekam er einen Job für den Observer. Der berühmte Plattenproduzent (und Manager von The Who) Kit Lambert erinnert sich, dass Cohn „um 1963“ als „dünner junger Mann – er sah aus wie 14 – in sorgfältig verschmutzten Turnschuhen“ auftauchte. Cohns Ansatz war perfekt auf sein Thema abgestimmt. Er schreibt: „Rock in den späten 60er Jahren war noch eine spontane Entzündung. Niemand kümmerte sich um langfristige Strategien; an ein Durchhalten war nicht zu denken, sobald der Nervenkitzel vorbei war. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass die Stones oder die Who in mehr als 30 Jahren noch auf den Brettern stehen würden, hätte ich ihn für verrückt gehalten.“
Cohn, der Sohn des Historikers Norman Cohn, Autor des Kultklassikers „The Pursuit of the Millennium“, wuchs in Irland auf, floh aber 1963 nach London, „dem Jahr, in dem die Beatles den Durchbruch schafften und sich das Klima von Tag zu Tag zu ändern schien“. Der großstädtische Konsumrausch, an dem er teilhatte, beschränkte sich nicht auf den Rock’n’Roll. Er schreibt, dass „Zeitungsredakteure, Buchverleger, Modemagazine und Filmfinanziers alle vom gleichen Fieber erfasst wurden. Fast über Nacht war es der heißeste Job, ein degenerierter Teenager zu sein“.
Als er 22 war, waren diese berauschenden Tage vorbei. „Noch während ich den Moment auskostete“, erinnert sich Cohn, “waren Rock und Pop bereits im Wandel. Die Welt, die ich kannte und genoss, war im Grunde genommen ein verbotenes Gewerbe, bevölkert von Abenteurern, Schlangenölverkäufern und inspirierten Verrückten. Aber ihre Zeit war fast vorbei. Die Szene wurde immer industrieller. Buchhalter und Bonzen verdrängten die wilden Männer. Schon bald war der Rock „nur noch ein weiterer Wirtschaftszweig, nicht mehr oder weniger exotisch als Autos oder Waschmittel“.
1968 nahm er den Vorschuss eines Verlegers an und verschanzte sich sieben Wochen lang in Connemara, um den ersten Entwurf zu schreiben.
Mein Ziel war ganz einfach: das Gefühl, den Puls des Rock einzufangen, wie ich ihn vorgefunden hatte. Meines Wissens hatte noch nie jemand ein ernsthaftes Buch über dieses Thema geschrieben, ich hatte also keine Vorläufer, die mich daran hindern konnten. Ich hatte auch keine Nachschlagewerke oder Nachforschungen zur Hand. Ich schrieb einfach aus dem Stegreif, was immer und wie immer der Geist mich bewegte. Genauigkeit schien mir nicht von größter Bedeutung zu sein (und das Buch ist im Ergebnis ein Morast von sachlichen Fehlern). Was ich wollte, waren Mut, Blitzlicht, Energie und Schnelligkeit. Das waren die Dinge, die ich an der Musik schätzte. Das waren die Dinge, die ich zu reflektieren versuchte, als ich ging.
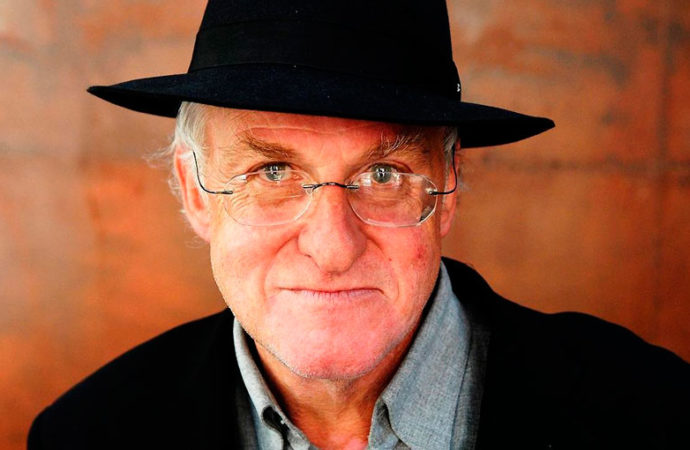
„Awopbop… “ war das Ergebnis: subjektiv, widerspenstig und ungewollt endgültig. Die Fragen nach gut und/oder schlecht waren nachträglich und zufällig gestellt. Cohn verarbeitete Erinnerungen und Eindrücke. „Hatte Dions „Ruby Baby“ einen ästhetischen Wert?“, fragt er. „Wen interessierte das? Was es hatte, war schmutzige Magie – der undeutliche, sexbesoffene Gesang, diese chaotischen Handclaps, das ganze glorreiche, ungemachte Bett.“
Von Bill Haley bis Jimi Hendrix spannt Cohn den Bogen des Rock’n’Roll, mit Kapiteln über Elvis Presley, The Twist, Phil Spector, die Beatles, die Rolling Stones, The Who, Bob Dylan und sogar die Monkees. „Ich habe über den Aufstieg und Fall von Superpop, die Lärmmaschine, das Image, den Hype und den schönen Schein der Rock’n’Roll-Musik geschrieben“, resümiert er. „Elvis, der auf seinem goldenen Cadillac fährt, James Brown, der sich in einem Anfall seiner Robe entledigt, Pete Townshend, der sein Publikum mit seiner Maschinengewehrgitarre abschlachtet, Mick Jagger, der an seinem Mikrofon hängt wie Tarzan Weissmüller im Dschungel, PJ Proby – all die heroischen Taten des Stoffs“.
1972 hat er sein Buch überarbeitet. In seinen „nachträglichen Überlegungen“ schreibt Cohn:
Ich habe weder den roten Faden des Buches verfälscht, noch habe ich versucht, meine Fehler zu kaschieren.
Das bedeutet, dass vor allem eine große Fehleinschätzung immer noch besteht. Ich war davon ausgegangen, dass der progressive Pop zu einem Minderheitenkult schrumpfen würde, und das ist nicht der Fall. Nun, in England lag ich nicht ganz falsch, denn das Interesse der Teenager war seit der Euphorie Mitte der sechziger Jahre stark zurückgegangen, und neue „schwere“ Künstler verkaufen sich kaum halb so gut wie die frühen Beatles oder Rolling Stones. Aber in Amerika habe ich völlig versagt – die Woodstock-Nation ist weiter gewachsen […] aber das Geld, der Hype und die Hysterie, die damit verbunden sind, sind immer noch dieselben.
Pop lebt nun eben doch. Trotzdem habe ich mich weiter von ihm entfernt, und zwar aus denselben Gründen, die ich schon vor drei Jahren genannt habe – die neue Feierlichkeit und Frömmigkeit, die sofortige Akzeptanz von Pisspottbarden als Messiasse, der Verlust von Energie, Ehrlichkeit und Humor, all die Dinge, die ihn ursprünglich so unwiderstehlich machten. Mehr und mehr habe ich mich in die Vergangenheit zurückgezogen und bin in den Rock ’n‘ Roll der fünfziger Jahre eingetaucht.[…]
Es ist nichts geschehen, was mich dazu veranlasst hätte, das zentrale Urteil von vor drei Jahren zu revidieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Rock seine besten Momente erlebt hat, und zwar alle, und wenn ich auf meine erste Ausgabe zurückblicke, bedaure ich nicht, dass ich das Neue zu sehr missbraucht habe, sondern dass ich dem Alten nicht liebevoll genug begegnet bin.
Quellen: The Guardian | Nik Cohn: Awopbopaloobop Alopbamboom. The Golden Age Of Rock, Reprint 1996
