Jörg R. Bergmann, Klatsch: Zur Sozialform der diskreten Indiskretion, De Gruyter Oldenbourg (Berlin), 2.Auflage 2022
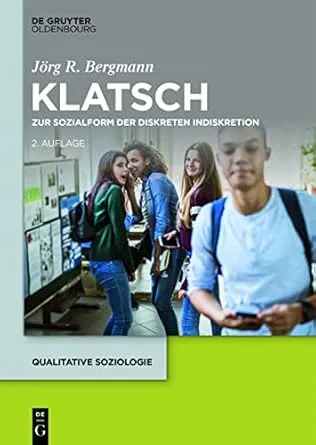
Mit der Entstehung der sozialen Medien ist auch die Bedeutung von Klatsch gewachsen.
Klatsch ist ein Phänomen, das in einfachen Stammesgesellschaften ebenso wie in der heutigen, digitalen Mediengesellschaft zu finden ist. Zwar wird Klatsch in allen Gesellschaften als Verletzung der Umgangsformen missbilligt, dennoch ist er quer durch alle sozialen Gruppen weit verbreitet und bildet für die Klatschakteure ein Faszinosum mit einen hohen Unterhaltungswert. Diesem oft als trivial eingeschätzten Phänomen widmet sich die vorliegende Studie, die nach 1987 in 2.Auflage neu bearbeitet wurde.
35 Jahre nach der Erstveröffentlichung bleibt es Bergmanns großes Verdienst, eine detaillierte, empirisch fundierte Analyse der inneren Organisation und sequentiellen Struktur dieser geschmähten und zugleich vergnüglichen Form der Kommunikation vorzulegen und diese anschließend für die Theoriebildung fruchtbar zu machen.[…] Dazu trägt auch die angenehme, gut lesbare und oftmals kurzweilige Wissenschaftsprosa bei.
Quelle: gesprächsforschung-online.de
Gestützt auf Transkriptionen und Protokolle realer Klatschgespräche wird gezeigt, dass Klatschgespräche bestimmt werden von einer triadischen Beziehungskonstellation, bei der die Klatschakteure über abwesende Bekannte oder Kollegen pikante Neuigkeiten austauschen und moralische Urteile fällen. Dabei stecken die Klatschakteure jedoch in einem Dilemma – der Drang des einen, ein vertrauliches Wissen zu teilen und die Erwartung des anderen, ins Vertrauen gezogen zu werden, geraten in Konflikt mit ihrer Loyalität gegenüber dem abwesenden Dritten. Die Lösung dieses Dilemmas verleiht dem Klatsch seine paradoxe Qualität.
Wer klatscht, begeht eine Indiskretion, verhält sich aber zugleich diskret, da er seine Informationen nicht beliebig streut, sondern unter dem Siegel der Verschwiegenheit weitergibt. Klatsch ist die Sozialform der diskreten Indiskretion. Aufbauend auf dieser Überlegung und in kritischer Auseinandersetzung mit anthropologischen, soziologischen und linguistischen Erklärungsansätzen entwickelt die Studie eine Theorie von Klatsch als einer eigenen Gattung der alltäglichen moralischen Kommunikation.
Wie Bergmann schreibt, entsteht Klatsch „aus dem Geist und der Praxis von Wissenschaft selbst“ , so dass „die Universitäten ein geradezu prädestinierter Ort für Klatsch sind“ . Nicht nur aus diesem Grund lohnt die Lektüre dieses Klassikers.
