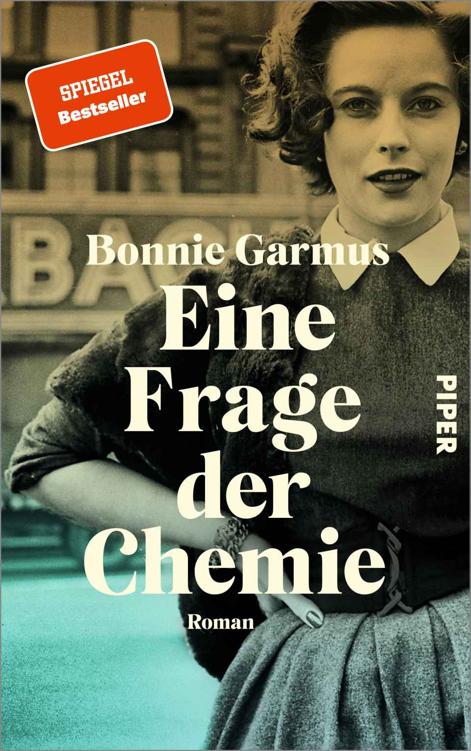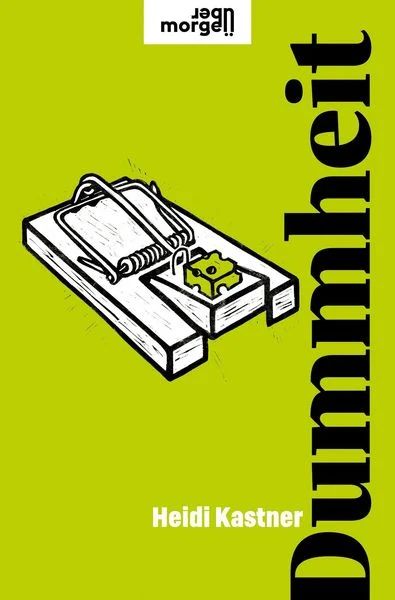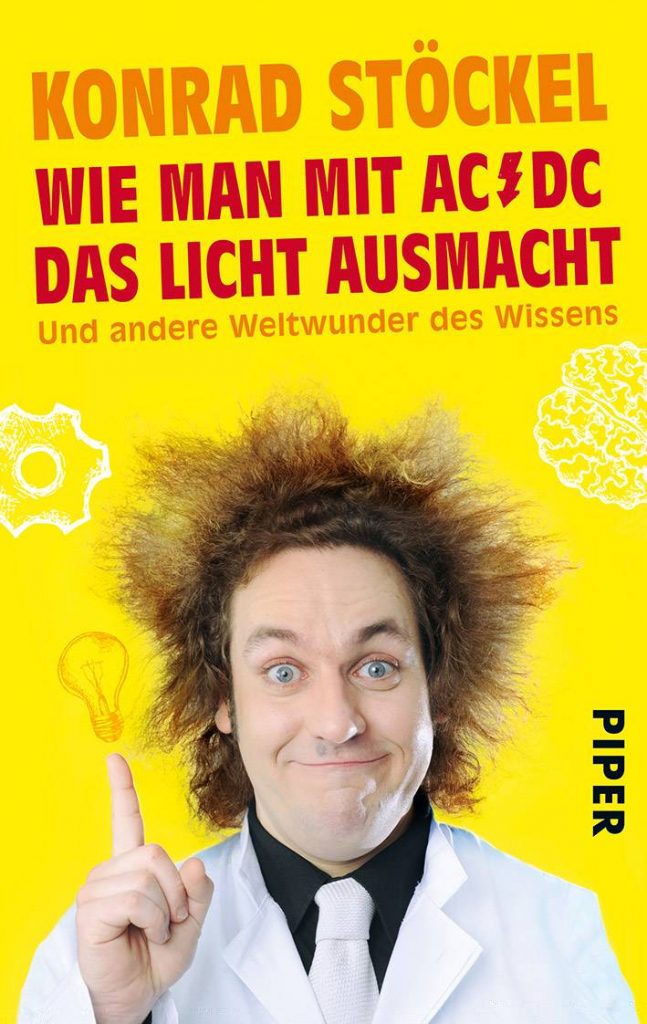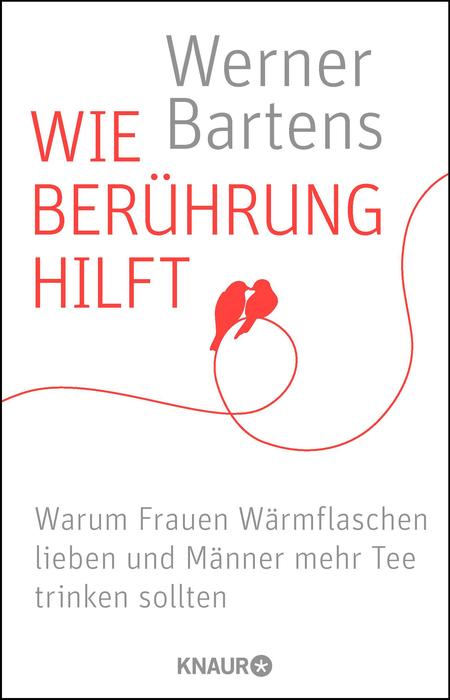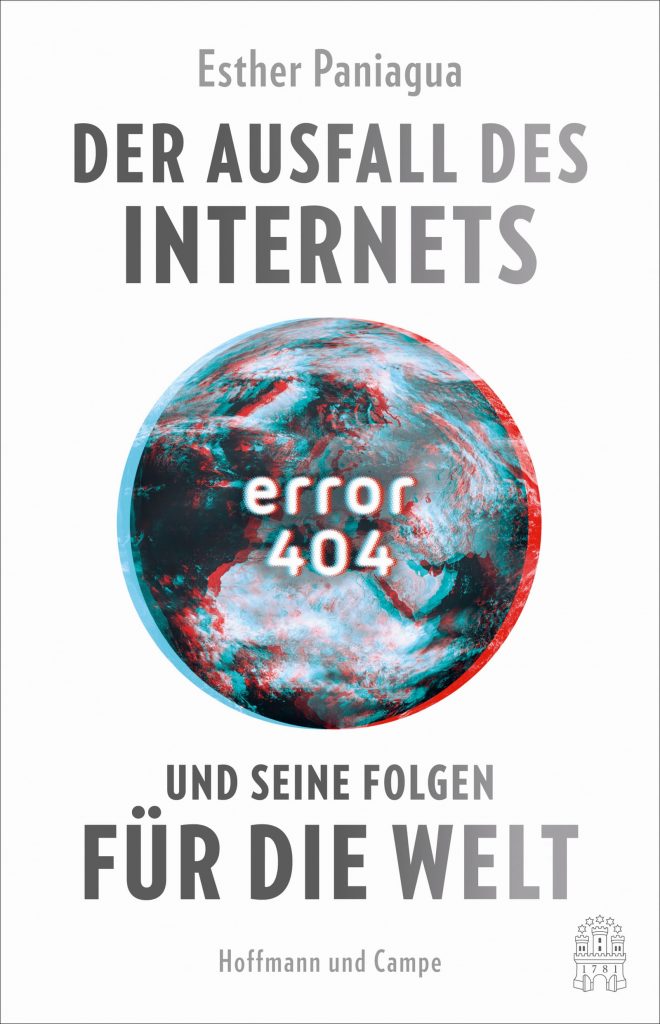
Error 404 ist ein Buch von Esther Paniagua über den drohenden Internet-Blackout, vor dem uns Experten seit Jahren warnen. Es beschreibt, wie es zu einem totalen Zusammenbruch kommen könnte, erörtert die potenziellen Auswirkungen und behandelt dringende Themen, die sich aus einer entscheidenden Frage ergeben: Wie hat sich das Internet von einer Quelle der Befreiung zu dem entwickelt, was es heute ist .
Die Frage lautet nicht, ob das Internet komplett ausfallen wird, sondern wann. Werden wir darauf vorbereitet sein? Oder wird die Welt ohne Internet im Chaos versinken?
Anfang Oktober 2021 fielen die Dienste von Facebook, Instagram und WhatsApp für einige Stunden aus. Die Panik, die gerade junge User daraufhin ergriff, sorgte allgemein für Erheiterung. Doch was bei einem kurzen Zeitraum noch lustig ist, wird ernst, wenn das komplette Internet betroffen ist, und nicht nur für ein paar Stunden.
Wissenschaftler haben errechnet, dass uns etwa 8 bis 10 Tage bleiben würden, bis unsere Zivilisation ohne Internet völlig zum Erliegen kommen würde. Längst ist das Internet integraler Bestandteil unserer kritischen Infrastruktur. Ein potenzieller Ausfall wird längst ernsthaft diskutiert, sei es durch die Überlastung der Serverfarmen, einen Sonnensturm oder einen militärischen Anschlag.
Im Buch werden die heutigen Themen, die Probleme unseres digitalen Lebens, die dahinter stehende Machtdynamik und die Aushöhlung der Demokratie analysiert.
„Immer mehr Stimmen warnen vor der Gefahr, dass der private Sektor das Gemeinwohl an sich reißt und dass Vorschriften ohne Transparenz, Rechenschaftspflicht und ein kollektives Mandat erlassen werden. Das wäre die Privatisierung des Regierens und die Bankrotterklärung einer demokratischen Regierungsführung, bei der die Entwicklung von Regeln alle betroffenen Bevölkerungsteile einbezieht. Die »GAFAM«s und »BAT«s dieser Welt missbrauchen ihre Macht nicht nur, um die Menschenrechte zu verletzen und in die Privatsphäre der Individuen einzudringen, sondern auch, um Steuern zu hinterziehen und sich vor Regulierungen zu schützen.“
GAFAM = Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, die größten Internetfirmen der Welt
– BAT = Baidu, Alibaba und Tencent
Mit einer kritischen und zugleich konstruktiven Perspektive bietet Error 404 auch eine Reihe konkreter Vorschläge und Denkansätze und ist für mich alles andere als „ein fader Abklatsch der Internetkritik„. Vielleicht passen dem Kritiker die gesellschaftspolitischen Ansätze der Autorin nicht, welche u.a. die „Gründung einer Allianz der demokratischen Nationen, die digitale Regeln festlegt“ vorsehen, um sowohl den oben genannten Konzernen als auch Ländern wie China und Russland mit ihren antidemokratischen und autoritären Strategien durch „partizipativere und transparentere Demokratien“ entgegen zu wirken.
„…was die Menschheit so weit gebracht hat, dass sie heute an diesem Punkt steht, ist weder das Internet noch die Digitalisierung. Beide spiegeln vielmehr die menschliche Verfassung wider und können die besten und schlechtesten Seiten der Menschen verstärken. Hass, Gewalt und Verbrechen werden auch weiter online reproduziert werden, Polarisierung und Fehlinformationen weiterhin verstärkt, Diskriminierung findet ihren Niederschlag in unseren Algorithmen, und jeden unserer analogen oder digitalen Schritte wird man potenziell überwachen können.
Die Allianz kann dazu beitragen, die verstärkte negative Einflussnahme einzudämmen und schrittweise umzukehren. Aber einen richtigen Wandel wird es nur geben, wenn wir bessere, integrativere und gerechtere Gesellschaften und partizipativere und transparentere Demokratien aufbauen. Das kann nur gelingen, wenn wir alles daran setzen, bessere Menschen hervorzubringen und dabei keinen Moment unsere Leitwerte aus den Augen verlieren.“
Esther Paniagua – Error 404. Der Ausfall des Internets und seine Folgen für die Welt, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2022
ISBN: 978-3-455-01437-2, 400 Seiten
Quelle: tintenfässchen, estherpaniagua.com