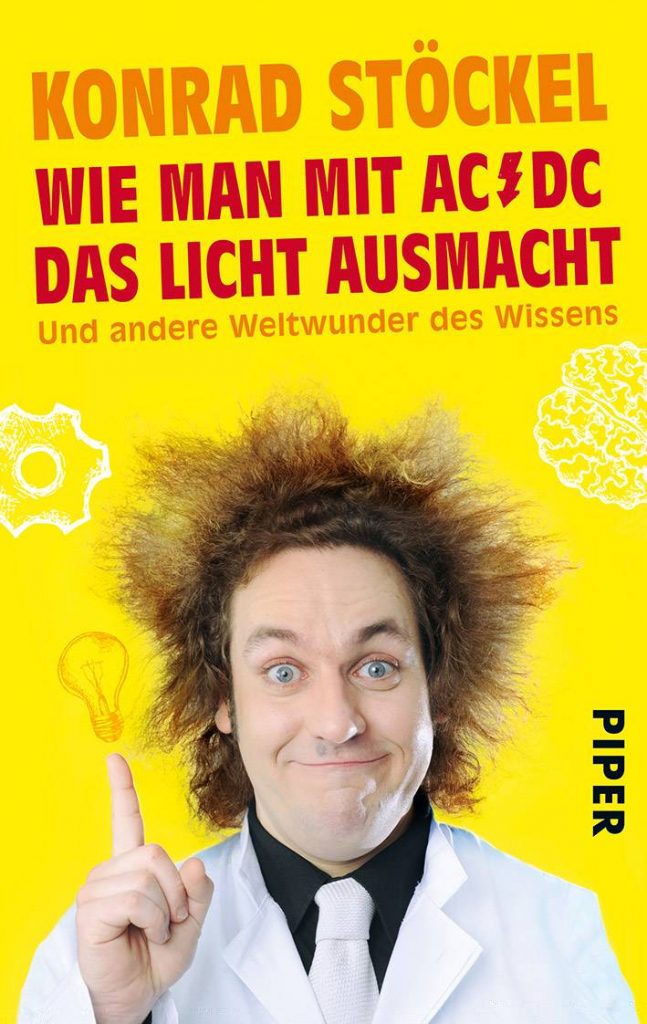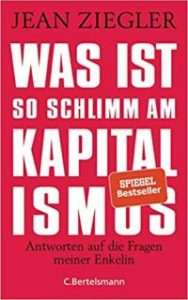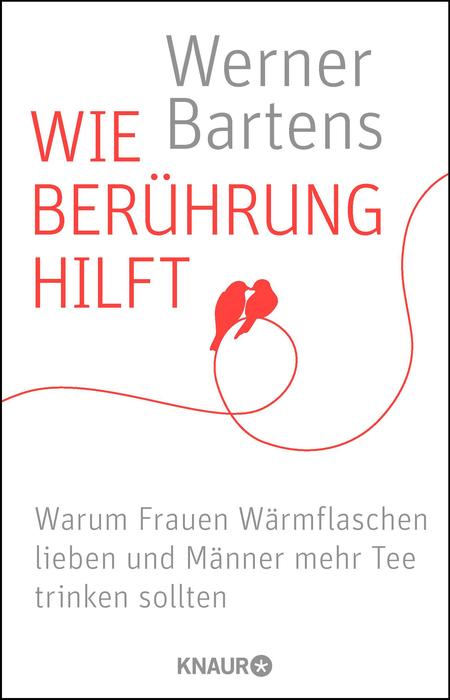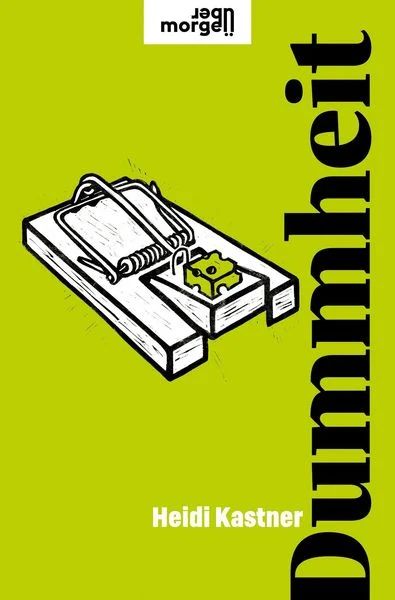
In diesem Buch geht es um die
Beschreibung eines Phänomens, das in der Geschichte der Menschheit schon mehr Schaden angerichtet hat als alle Waffen, Bakterien und Viren gemeinsam und das das Potenzial hat, unseren Untergang zu bewirken.
Wow, das klingt irgendwie bedrohlich und macht doch auch neugierig, oder? Und worum geht es nun in dem Buch?
Heidi Kastner ist Psychiaterin, Gerichtsgutachterin und Autorin. In ihrem jüngsten Buch „Dummheit“ beschäftigt sie sich mit dem Thema und den Auswirkungen von dummen Entscheidungen auf die Gesellschaft.
„Dummheit begegnet uns in vielerlei Form – doch woran kann man sie erkennen?“ Was haben so unterschiedliche Dinge wie „alternative Fakten“, menschenleere Begegnungszonen in Satellitensiedlungen und Schönheits-OPs als Maturageschenk gemeinsam? Heidi Kastner wagt sich an den aufgeladenen Begriff der Dummheit und betrachtet sowohl die sogenannte messbare Intelligenz (IQ) sowie die „heilige Einfalt“ und die emotionale Intelligenz, deren Fehlen immensen Schaden anrichten kann. Was treibt Menschen, die an sich rational-kognitiv nachdenken könnten, dazu, sich und andere durch „dumme“ Entscheidungen ins Unglück zu stürzen? Wie ist kollektive Bereitschaft zu Ignoranz zu erklären und warum nimmt dieses Phänomen scheinbar so eklatant zu? Gibt es einen Konsens dafür, dass langfristig fatales, aber unmittelbar subjektiv vorteilhaftes Verhalten als „dumm“ anzusehen ist? Sind Abwägen und Nachdenken altmodisch? Und was um Himmels Willen ist so attraktiv am Konzept des Leithammels, der uns das Denken abnimmt, oder des Influencers, der uns den einzig wahren Weg zeigt?
(Zitat aus der Buchbeschreibung)
Ich weiß, es ist gefährlich, ihn als dumm zu bezeichnen – aber mir fiel sofort Donald Trump ein. Ist er mit seinen unzähligen Lügen und rassistischen Äußerungen ein Beispiel für intelligentes Verhalten oder für Dummheit? Kastner antwortete dazu in einem Interview:
Beides. Er war in der Lage, die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung wahrzunehmen. Und darauf mit einem – natürlich hohlen – Heilsversprechen zu reagieren. Der American Dream, der besagt, dass man alles schaffen kann, wenn man sich anstrengt, ist schon lange nicht mehr wahr. Manche strengen sich über ihre Verhältnisse an und leben trotzdem in prekären Verhältnissen. Dieses Scheitern hat große Teile der Bevölkerung massiv desillusioniert und zu einer Sehnsucht nach stabilen Verhältnissen geführt. Das hat Trump wahrgenommen und ist als Messias aufgetreten. Der Slogan „Make America Great Again“ war nicht wirklich eine grandiose Leistung, aber hat auf das Unzufriedenheits- und Protestpotenzial abgezielt.
Er hat sich dann hingestellt wie der Rattenfänger von Hameln und gesagt: „Wenn ihr mir folgt, werde ich das alles lösen.“ Was natürlich nicht funktionieren kann. Es ist immer die Strategie aller Populisten, simple Lösungen für komplexe Probleme anzubieten. Leute, die schon länger unter solchen Problemen leiden, haben eine erhöhte Neigung, solchen Menschen auf den Leim zu gehen. Die Entscheidungen, die Trump als Präsident getroffen hat, waren dann teilweise dumm. Wenn man zum Beispiel die langfristigen Auswirkungen auf den Klimaschutz betrachtet. Da ging es nur um Trumps kurzfristige und persönliche Ziele, wie etwa seine Popularität aufrechtzuerhalten. Oder seiner Spendenklientel dabei zu helfen, durch Ausbeutung von Ressourcen ihren Reichtum noch weiter zu vergrößern.
Zitat aus: Interview mit Christian Stüwe
Das Buch „Dummheit“ wurde im Oktober 2021 veröffentlicht, war innerhalb von 14 Tagen ausverkauft und ist aktuell in 9. Auflage erschienen.
Heidi Kastner: Dummheit.
Kremayr & Scheriau Verlag, Wien 2021.
128 Seiten, ISBN: 9783218012881