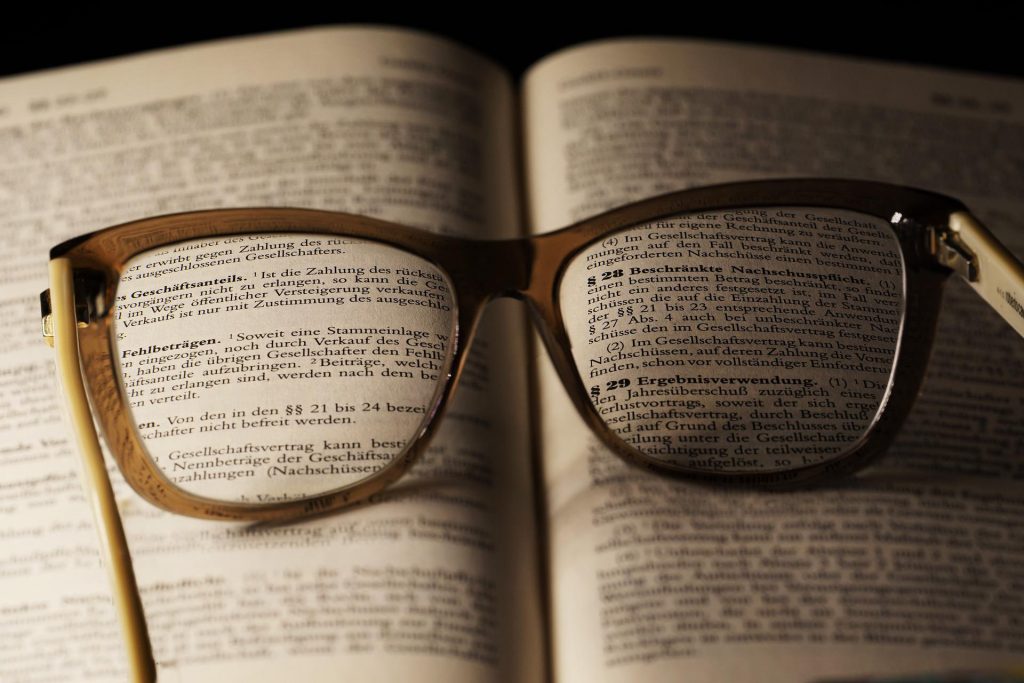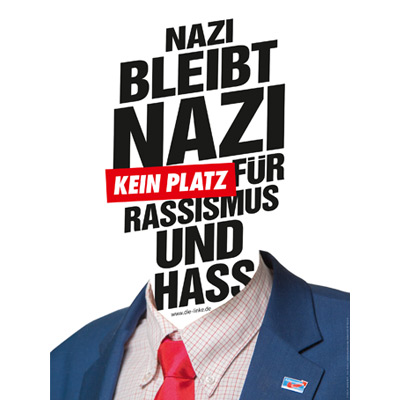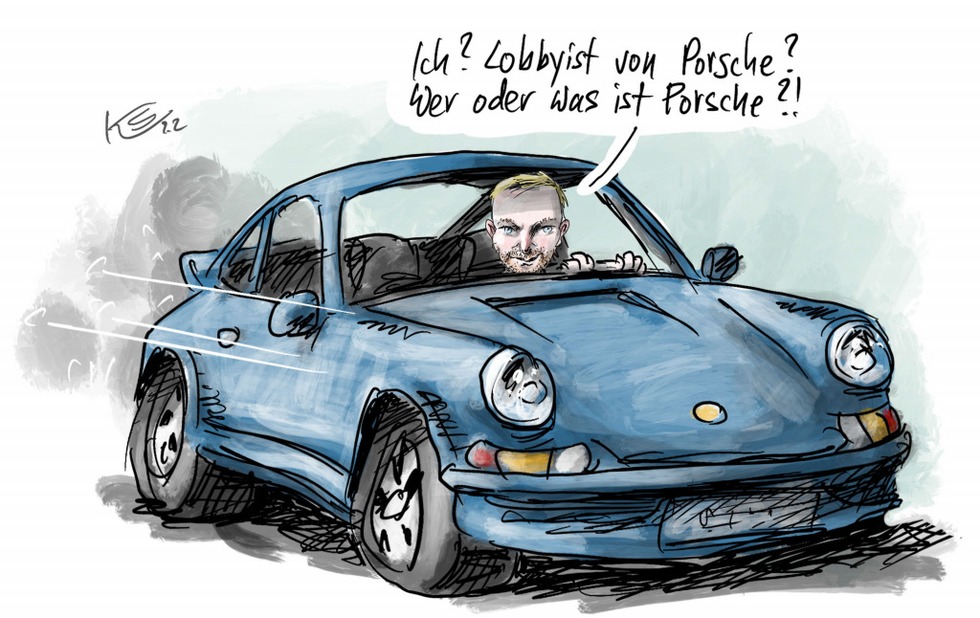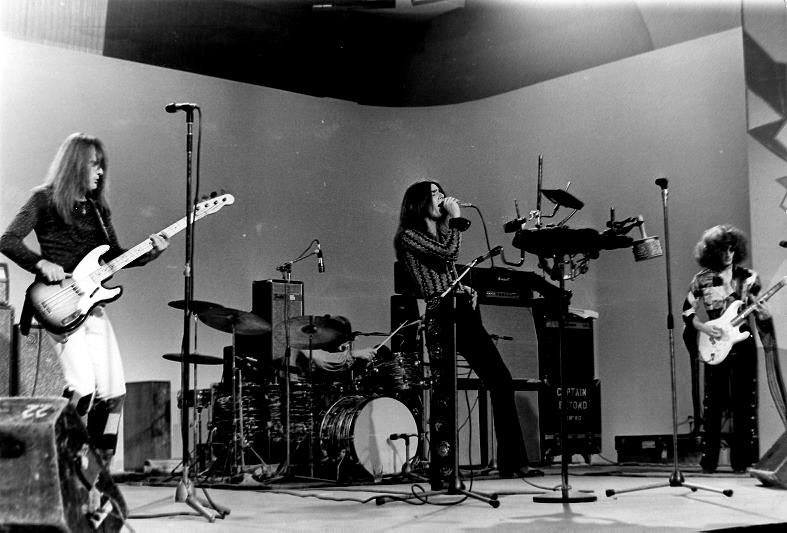Das was, allen voran vom Deutschen Brauer-Bund, gefeiert wurde und als „Reinheitsgebot“ von 1516 bezeichnet ist, wird von vielen als die älteste, noch gültige Lebensmittelgesetzgebung der Welt angesehen – eine weitere Mär (siehe unten). Ursprünglich sollten damit u.a. Preise reguliert und Verfälschungen des Getränks vorgebeugt sowie chemische oder andere Zusätze ausgeschlossen werden. Denn neben Kräutern zum Würzen kamen im Mittelalter auch diverse andere „Zutaten“ in das Bier hinein, wie z.B. Ochsengalle, Eichenrinde, Wermut, Lorbeer, Schafgarbe, Stechapfel, Enzian, Anis, Rainfarn, Fichtenspäne, Kiefernwurzeln, aber auch Bilsenkraut.
Das „Reinheitsgebot“, auf das sich auch heute noch vielfach bezogen wird, war aber nur eine Textpassage, ein Bestandteil der Bayerischen Landesordnung von 1516. Neben den Preisen wurden darin auch die Inhaltsstoffe des Bieres geregelt:
„Item wir ordnen / setzen / und wöllen mit Rathe unnser Lanndtschaft / das füran allennthalben in dem Fürstenthumb Bayren / auf dem Lannde / auch in unnsern Stetten und Märckthen / da deßhalb hieuor kain sonndere Ordnung ist / von Michaelis bis auff Georij / ain Mass oder Kopfpiers über ainen Pfenning Müncher Werung / unnd von Sant Jörgentag / bis auff Michaelis / die mass über zwen Pfenning derselben Werung / unnd derennden der Kopf ist / über drey Haller / bey nachgesetzter Pene / nicht gegeben noch außgeschennckht sol werden. Wo auch ainer nit Merzen / sonder annder Pier prawen / oder sonnst haben würde / sol Er doch das / kains wegs höher / dann die maß umb ainen Pfenning schennckhen / und verkauffen. Wir wöllen auch sonnderlichen / das füran allenthalben in unsern Stetten / Märckthen / unnd auf dem Lannde / zu kainem Pier / merer Stuckh / dann allain Gersten / Hopffen / und Wasser / genomen unnd gepraucht sölle werden. Welher aber dise unnsere Ordnung wissentlich überfaren unnd nit hallten würde / dem sol von seiner Gerichtzöbrigkait / dasselbig vas Pier / zuestraff unnachläßlich / so offt es geschicht / genomen werden. Jedoch wo ain Geüwirt von ainem Pierprewen in unnsern Stettn / Märckten / oder aufm Lande / yezuezeyten ainen Emer Piers / zwen oder drey / kauffen / und wider unntter den gemainen Pawzsuolck ausschennckhen würde / demselbenn allain / aber sonnst nyemandts / sol die mass / oder der kopff piers / umb ainen haller höher dann oben gesetzt ist / zegeben / unnd außzeschennckhen erlaubt unnd unuerpotten sein.“
Übersetzung:
„Wir verordnen, setzen und wollen mit dem Rat unserer Landschaft, dass forthin überall im Fürstentum Bayern sowohl auf dem Lande wie auch in unseren Städten und Märkten, die keine besondere Ordnung dafür haben, von Michaeli (29. September) bis Georgi (23. April) eine Maß (bayerische, entspricht 1,069 Liter) oder ein Kopf (halbkugelförmiges Geschirr für Flüssigkeiten – nicht ganz eine Maß) Bier für nicht mehr als einen Pfennig Münchener Währung und von Georgi bis Michaeli die Maß für nicht mehr als zwei Pfennig derselben Währung, der Kopf für nicht mehr als drei Heller (gewöhnlich ein halber Pfennig) bei Androhung unten angeführter Strafe gegeben und ausgeschenkt werden soll.
Wo aber einer nicht Märzen sondern anderes Bier brauen oder sonstwie haben würde, soll er es keineswegs höher als um einen Pfennig die Maß ausschenken und verkaufen. Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gerste, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.
Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Fass Bier, so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden.
Wo jedoch ein Gäuwirt von einem Bierbräu in unseren Städten, Märkten oder auf dem Lande einen, zwei oder drei Eimer (enthält etwa 64 Liter) Bier kauft und wieder ausschenkt an das gemeine Bauernvolk, soll ihm allein und sonst niemand erlaubt und unverboten sein, die Maß oder den Kopf Bier um einen Heller teurer als oben vorgeschrieben ist, zu geben und auszuschenken.
Auch soll uns als Landesfürsten vorbehalten sein, für den Fall, dass aus Mangel und Verteuerung des Getreides starke Beschwernis entstünde, nachdem die Jahrgänge auch die Gegend und die Reifezeiten in unserem Land verschieden sind, zum allgemeinen Nutzen Einschränkungen zu verordnen, wie solches am Schluss über den Fürkauf ausführlich ausgedrückt und gesetzt ist.“ [Wikipedia]
Auch war in diesem Papier noch nicht die Rede von Hefe.
„Als Grund dafür wird häufig angenommen, dass die Existenz derartiger Mikroorganismen schlicht noch unbekannt war. Dies stimmt nur insofern, als die genaue Wirkungsweise der Hefe bei der alkoholischen Gärung unbekannt war. Hefe an sich war bekannt, Brauer gaben die Hefe des letzten Gärvorgangs der neu zu vergärenden Anstellwürze zu. Ein Hefner, im mittelalterlichen Brauwesen ein eigenständiger Beruf, pflegte und vermehrte die Hefe über Braupausen hinweg. Im Münchner Bäcker- und Brauerstreit war es bereits 1481 darum gegangen, ob die Bäcker den Brauern deren bei der Gärung gebildete Überschusshefe nach altem Brauch abkaufen müssen.
Die weitverbreitete Behauptung, das „bayerische Reinheitsgebot“ sei das älteste Lebensmittelgesetz der Welt, ist eine reine Marketingaussage der Brauereiwirtschaft ohne geschichtliche Fundierung. So enthält z. B. der Codex Hammurapi aus dem 18. Jahrhundert v. Chr. umfangreiche Bestimmungen zum Lebensmittelrecht, wobei Bier eine bedeutende Rolle einnimmt.
Entgegen der heute weit verbreiteten Auffassung einer Kontinuität des Reinheitsgebots bestand die in der bayerischen Landesordnung von 1516 erlassene Brauvorschrift nur kurz. Bereits ein herzoglicher Erlass von 1551 erlaubte Koriander und Lorbeer als weitere Zutaten bayerischer Biere und verbot dagegen ausdrücklich die Verwendung von Bilsenkraut und Seidelbast. Die bayerische Landesverordnung von 1616 ließ zudem Salz, Wacholder und Kümmel zur Bierproduktion zu.
1548 erhielt der Freiherr von Degenberg das Privileg, nördlich der Donau Weizenbier zu brauen, obwohl Weizen gemäß der bayerischen Landesordnung von 1516 zum Bierbrauen nicht zulässig war. Als 1602 das Geschlecht der Grafen von Degenberg ausstarb, fiel das Privileg zum Weizenbierbrauen an den Herzog Maximilian I. zurück, woraufhin dieser mehrere Weizenbierbrauhäuser errichtete.“ [Wikipedia]
Hefe war also schon bekannt und dass sich nach der Gärung eine beige „Paste“ absetzte. Mit Hilfe dieser Paste, fand man sodann heraus, ließ sich der folgende Sud schneller und in konstanterer Qualität erstellen. Trotzdem wurde Hefe im sogenannten Reinheitsgebot nicht als Bestandteil aufgeführt, weil man sie als „Neben- oder Abfallprodukt der Bierherstellung ansah“. [Quelle]
Im Verlauf der Zeit hat es viele neue Regelungen und Gesetze gegeben, die Aussagen zur Bierherstellung beinhalteten. Was heute als Bier bezeichnet werden darf, ist in der Bierverordnung von 2005 geregelt. Danach ist die Einhaltung der Herstellungsvorschriften im Vorläufigen Biergesetz (VorlBierG) vorgegeben.
„Besonders strenge Vorschriften gelten nur noch für die untergärige Bierherstellung in Deutschland für den deutschen Markt. Hersteller von importiertem Bier sind aufgrund des nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes von 1987 angepassten deutschen Rechts nicht an diese Vorschriften gebunden; auch deutsche Brauereien können davon abweichen, wenn sie untergäriges Bier für den Export produzieren, oder für „besondere Biere“ [Paragraph 9 Absatz 7 des Vorläufigen Biergesetzes, eine Art Schlupfloch für Biere, die nicht dem Reinheitsgebot entsprechen] eine Ausnahmegenehmigung erhalten.“ [Wikipedia]
In Deutschland sorgt der Deutsche Brauer-Bund e.V. für die „Illusion eines naturbelassenen Produkts“ und behauptet nachwievor,
Das Reinheitsgebot schreibt vor, dass zur Bierherstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden dürfen. Es steht für die Bewahrung einer althergebrachten Handwerkstechnik und gilt zugleich als älteste, heute noch gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt. [Quelle]
Dabei können aber auch in Deutschland z.B. zum Brauen von obergärigem Bier andere Zutaten wie z.B. die Verwendung von technisch reinem Roh-, Rüben- und Invertzucker, sowie von Stärkezucker und aus Zucker hergestellten Farbmittel zulässig sein. Ganz zu schweigen von den eingesetzten technischen Prozessen und ihren möglichen Rückständen im Bier.
„Da wäre zum Beispiel das Wortungetüm Polyvinylpolypyrrolidon – kurz PVPP. Mithilfe dieser kleinen Kunststoffpartikel werden Trübstoffe aus dem Bier gefiltert, um die Haltbarkeit zu verbessern. Der Einsatz solcher Klärmittel ist laut Gesetz zulässig, wenn sie bis auf „technisch unvermeidbare Anteile“ vor der Abfüllung wieder aus dem Bier verschwinden. Letzteres stellt allerdings eine Dissertation infrage, die am Lehrstuhl für Technologie der Brauerei der Technischen Universität München eingereicht wurde: Ihr zufolge bleibt ein Teil des Plastikgranulats im Bier enthalten. Gleiches gilt übrigens für den technischen Hilfsstoff Kieselgur.
Nun wird PVPP zwar nicht flächendeckend in der Bierherstellung eingesetzt und sogar als Bindemittel für Tabletten genutzt – Panik muss deshalb kein Biertrinker bekommen. Doch für Oliver Wesseloh [Inhaber der Kehrwieder Kreativbrauerei, Hamburg] gibt es noch viele andere Argumente, die den Mythos Reinheitsgebot entzaubern. Umkehrosmose, Farbebier, High-Gravity-Brewing lauten die entsprechenden Fachbegriffe. „Das alles sind hochtechnische Verfahren in industriellen Fertigungsprozessen, die mit handwerklichen Produkten nichts zu tun haben“, schimpft Wesseloh und vergleicht den Technisierungsgrad einer modernen Brauerei mit der Brücke von Raumschiff Enterprise. Tatsächlich ist der industrielle Charakter der Bierproduktion für die Unesco ein Argument, das Reinheitsgebot vorerst nicht in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes aufzunehmen.“ [Die Zeit]
Viele Braumeister kritisieren das Festhalten am „Mythos“ Reinheitsgebot und fordern keineswegs eine Abschaffung, wünschen sich aber eher, „dass größerer Wert auf natürliche Zutaten gelegt wird.“ [Die Zeit]. Am Ende solle der Verbraucher entscheiden, ob er Einheitsgeschmack oder lieber Vielfalt haben wolle.