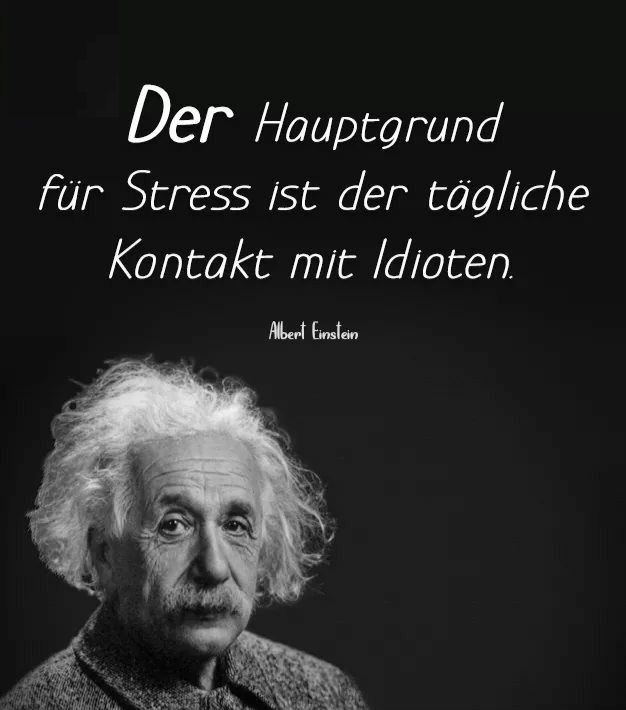Das Buhlen der CDUCSU um rechte Wähler*innen geht weiter. Dazu passen die Aussagen von Fritze Merz und CSU-Döner-Söder über ein „Stadtbild“. Damit sind nicht Graffitis, Hundescheisse oder ausgespuckte Kaugummis gemeint, sondern Menschen. Und zwar solche, die in ihren (rechten) Augen nicht dort hingehören: Migrant*innen.
„Das Stadtbild muss sich wieder verändern. Es braucht einfach mehr Rückführungen.“ Willkommen sei in Deutschland, wer Arbeit habe. Wer aber keine Duldung, keine Beschäftigung habe oder gar Straftaten begehe, müsse zurück in die Heimat. Der „Frankfurter Allgemeinen“ sagte Söder: „Die Situation an den Grenzen hat sich verändert, aber noch nicht das Bild in vielen Städten.“
Quelle: BR
Bei einem Termin in Posdam sagte Merz: „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.“ [STERN]
Brandenburgs Grünen-Vorsitzender Clemens Rostock warf Merz Rassismus vor. „Problematisch ist nicht nur, dass Friedrich Merz Migration zum Problem erklärt – sondern vor allem, dass er offenbar Menschen allein nach ihrem Aussehen als nicht dazugehörig markiert.“ Und weiter: „Das ist rassistisch, und das ist ein echtes Problem für unser Land. Wer Integration will, darf Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion zum Sündenbock machen.“ [STERN]
Söder und Merz machen sich bei der Verwendung des Begriffs „einen Kampfbegriff der AfD zu eigen, mit dem diese Erfolg hatte. In Gelsenkirchen warb die Alternative für Deutschland beim Kommunalwahlkampf „für eine saubere Heimat mit einem gepflegten Stadtbild“. [TAZ]
Alle Migrant*innen in eine Schublade werfen, mit Kriminaltät verknüpfen, damit „Rückführungen“ (was ein Unwort!) legitimieren und flugs schwappt die braune AfD-Soße ins Söder’sche Döner über. Ich könnte kotzen!